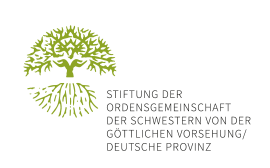1. Definition
2. Ziele
3. Grundsätze
4. Handhabung der Pflegedokumentation
5. Dokumentationsführung
6. Einführung in das mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell (in Anlehnung an Fr. Dr. Cora van der Kooij)
7. Pflegeprozess / Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege
8. Inhalte der Pflegedokumentation
9. Durchführung
9.1. Module
9.1.1. Modul: Persönlichkeit
9.1.2. Modul: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
9.1.3. Modul: Mobilität
9.1.4. Modul: Pflegerische Versorgung / Selbstversorgung
9.2. Risikofaktoren / Pflegerische Einschätzung
10. Pflegekarte
11. Stammblatt (Vorgehensweise, keine Ausfüllhilfe)
12. Biographiebogen
13. Medikamentenblatt
14. Kontrollblatt
15. Nachweise
16. Pflegebericht
17. Signalleiste
18. Fragen an den Arzt
19. Pflegeverlegungsbericht
20. Indikationsformulare
20.1. Wunddokumentation
20.2. Bewegungsplan
20.3. Inkontinenzversorgung / Toilettentraining
20.4. Schmerz
20.5. Einfuhrprotokoll
21. Wichtige zu dokumentierende Informationen
1. Definition
Folgt.
2. Ziele
- Folgt
3. Grundsätze
Vor dem Einzug eines neuen Bewohners erhält der Wohnbereich / die Etage eine Dokumentationsmappe mit allen Formularen, die zur Grundausstattung gehören. Werden weitere Indikationsformulare benötigt, so ergänzt die zuständige Pflegefachkraft diese.
4. Handhabung der Pflegedokumentation
Jede examinierte Pflegefachkraft mit einem Mindeststellenanteil von 50% ist für eine bestimmte Anzahl von Bewohnern zuständig. Jede Fachkraft steuert für die ihr anvertrauten Bewohner den gesamten Pflegeprozess. Die Anzahl der Bewohner richtet sich nach der Größe des Wohnbereiches, der Größe der Beziehungspflegegruppe und dem Fachkräfte-Anteil innerhalb dieser Gruppe. Die Zuordnung steuert die WBL in Rücksprache mit PDL.
Die Verantwortung für die Pflegedokumentation beinhaltet folgende Aspekte:
Die zuständige Pflegefachkraft:
- ist für die ordnungsgemäße Führung der Pflegedokumentation bei den benannten Bewohnern verantwortlich.
- ist Ansprechpartner für alle an der Pflege und Betreuung beteiligten Personen.
- ist Verantwortlich für Koordination aller Abläufe und Prozesse, die den Bewohner betreffen.
- plant, evaluiert und nimmt entsprechende Anpassungen an der Pflegeprozessplanung vor. Die Pflegeprozessplanung wird bei Bedarf evaluiert.
- integriert die Ergebnisse aus der Pflegevisite und der Bewohnerbesprechung in die Pflegeprozessplanung.
- erstellt die Pflegeanamnese innerhalb der ersten Tagen. Aus den Informationen der Anamnese entwickelt sich die Pflegeplanung. Dieser Prozess geht fließend ineinander über. Nach acht Wochen ist die Pflegeprozessplanung erstellt.
Bei Kurzzeitpflegegästen ist der gesamte Prozess auf fünf Tage reduziert.
5. Dokumentationsführung
Alle Eintragungen von Beobachtungen und Informationen in der Pflegedokumentation sind mit Kugelschreiber (Dokumentenecht) durchzuführen.
Dokumentenechtheit bedeutet:
- Keinen Bleistift verwenden
- Kein Tipp-Ex o.ä. verwenden
- Keine Eintragungen überkleben
- Falsche Eintragungen durchstreichen, und mit Begründung / Hinweis versehen. Der Ursprungstext muss noch lesbar sein
- Keine Freiräume im Berichteblatt lassen
- Dokumentationssystem so aufbewahren, dass der Zugriff durch Unbefugte nicht möglich ist
- Mitarbeiter aus dem Frühdienst dokumentieren in blau
- Mitarbeiter aus dem Spätdienst dokumentieren in grün
- Mitarbeiter aus dem Nachtdienst dokumentieren in rot
- Betreuungsassisitenten dokumentieren in Lila
- Mitarbeiter anderer Fachbereiche dokumentieren in schwarz
- Jeder Eintrag ist mit einem Handzeichen versehen. Die Handzeichen werden durch die Einrichtung vorgegeben.
6. Einführung in das mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell (in Anlehnung an Fr. Dr. Cora van der Kooij)
Das Mäeutische Pflege- und Betreuungsmodell ist das einzige Modell, welches die Beziehung zwischen dem Bewohner und dem Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. In der pflegerischen Versorgung nach dem mäeutischen Pflege- und Betreuungsmodell geht es um den bewusst erlebten Kontakt mit dem Bewohner.
7. Pflegeprozess / Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege
Die Pflegeprozessplanung beginnt mit dem Einzug des Bewohners. Ab dem ersten Tag werden hier Erkenntnisse über den gewohnten oder bekannten Ablauf der pflegerischen Versorgung festgehalten. Dies kann zu Beginn erst einmal Stichpunktartig sein. Wichtig ist, dass der Ablauf handlungsleitend beschrieben ist. Der Zeitraum der Fertigstellung der Pflegeprozessplanung ist den Checklisten zur vollstationären Aufnahme oder des Kurzeitpflege-Aufenthaltes zu entnehmen. Es wird das Befinden und die Gewohnheiten vor und während des Einzugs und während der Phase des Eingewöhnens festgehalten. Während der ersten Wochen entdecken Mitarbeiter fast jeden Tag neue Wünsche und Bedürfnisse des neuen Bewohners. Erkenntnisse oder Erlebnisse der Mitarbeiter mit dem Bewohner werden direkt in der Pflegeprozessplanung notiert. Beobachten Sie, ob es sich um ein einmaliges Verhalten oder um ein ständig wiederkehrendes Verhalten handelt. Dieses Verhalten muss Berücksichtigung in der Pflegplanung finden.
Die Pflegeprozessplanung bleibt so lange gültig, bis eine Veränderung des Bewohners festgestellt wird. Diese Veränderung wird unter dem entsprechenden Modul festgehalten. Das Blatt der Pflegeprozessplanung wird in die Archivmappe abgeheftet, sobald dieses nicht mehr aktuell ist.
8. Inhalte der Pflegedokumentation
- Modul: Persönlichkeit
- Modul: Kognitive und Kommunikative Fähigkeiten
- Modul: Mobilität
- Modul: Pflegerische Versorgung / Selbstversorgung
- Pflegekarte
- Stammblatt
- Biographiebogen
- Medikamentenblatt
- Kontrollblatt (Vitalzeichen)
- Nachweise (medizinische und Grundpflege)
- Pflegebericht
- Fragen an den Arzt (ärztliche VO)
- Pflegeverlegungsbericht
- Signalleiste
- Indikationsformulare:
- Schmerzerfassung (BESD und NRS)
- Wunddokumentation
- Bewegungspläne
- Einfuhrplan
- Kontinenzförderung
9. Durchführung
9.1. Module
Bedürfnisse / Ressourcen
Es wird bei jedem Modul nach den Bedürfnissen / Ressourcen des Bewohners gefragt. Welche Bedürfnisse hat der Bewohner aus Erzählungen oder aus seiner Biografie begründet. Was kann der Bewohner noch selbst oder was möchte er wieder können? Es geht um Personen, Gewohnheiten und Gegenstände, die für den Bewohner wichtig sind. Was hat eine sinngebende Bedeutung? Woraus schöpft er Lebensfreude? (Religion, Interessen, Besuche bestimmter Menschen, Spazierfahrten, Körperkontakt, Bestätigung..)
Verhalten / Erleben
Unter Verhalten / Erleben wird eingetragen, wie sich der Bewohner in der Regel zu dem jeweiligen Modul verhält. Wie erlebt der Bewohner sich selbst oder wie erleben die Mitarbeiter ihn? Dabei kommt es immer darauf an, sich zu fragen, welches Erleben dem Verhalten zugrunde liegt und wie er sich fühlt.
- Hat der Bewohner Kontakte zu Mitbewohnern oder Mitarbeitern?
- Wie erlebt er sich?
- Wie verhält er sich in Gemeinschaft, in Gruppenangeboten oder bei der Einzelbetreuung?
- Kann der Bewohner von sich aus aktiv werden? Kann er seinen Tagesablauf selbst strukturieren?
- Welche Bewältigungsstrategien nutzt er?
Die Punkte "Bedürfnisse / Ressourcen" und "Verhalten / Erleben" sind ausführlich und individuell zu beschreiben. Sollte der Platz pro Modul zur Beschreibung nicht ausreichen, wird ein zweites Blatt dazu genommen und mit A und B gekennzeichnet. Alte Pflegplanungsblätter werden in dem Archivordner abgeheftet und ein neues Blatt wird angelegt.
9.1.1 Modul: Persönlichkeit
Unter diesem Punkt werden die Persönlichkeit und die Charaktereigenschaften des Bewohners beschrieben. Der Umgang mit dem Bewohner, der sich aus den positiven Kontaktmomenten ergeben hat, wird in der Pflegekarte notiert. Kernqualitäten sind Eigenschaften, die zum Wesen (Kern) einer Person gehören. Sie prägt den Menschen, so dass uns sofort eine Charaktereigenschaft einfällt, wenn wir an den Bewohner denken (z.B. Sorgfältigkeit, Ordnungssinn, Tatkraft, Religiosität, Einfühlungsvermögen, etc.). Es können auch Charaktereigenschaften beschrieben werden, die den Umgang und die Pflege erschweren (z.B. Abwehrendes Verhalten, Eigensinn, ständige Wiederholungen, Klammerndes Verhalten, Angst, Rückzug, etc.).
Teilnahme an Veranstaltungen
Es wird die erfolgte Teilnahme dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt über die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, der Seelsorge und der zuständigen Betreuungsassistenten.
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Ein Verweis auf den Wochenplan in den Zimmern zeigt die regelmäßigen Aktivitäten und Beschäftigungen an, die für den Bewohner wichtig sind. Er wird vom Sozialen Dienst geführt und kann von allen Mitarbeitern ergänzt werden. Die Eintragungen werden in der Regel vom Sozialen Dienst und der Seelsorge übernommen. Wenn kein Wochenplan im Zimmer vorliegt, muss eine Begründung angegeben werden (z.B. Bewohner wünscht keinen Plan) und die Aktivitäten müssen in der Tagesgestaltung festgehalten werden.
Es soll angekreuzt werden, wie der Bewohner von Angeboten erfährt und ob er Hilfe benötigt, wenn er diese wahrnehmen möchte. Es werden regelmäßige Besuchskontakte von Angehörigen, Freunden, Betreuern, Seelsorge und dem Sozialen Dienst eingetragen.
9.1.2. Modul: Kognitive und Kommunikative Fähigkeiten
Es wird erfasst, in wie weit die geistigen Funktionen in den Bereichen Persönlichkeit, Situation, Ort und Zeit vorhanden sind. Sind diese Funktionen beeinträchtigt, so wird beschreiben, in wie weit es zu Einschränkungen kommt und wie sich diese durch das Verhalten des Bewohners bemerkbar machen. Ebenso wird die Art und Weise der möglichen Kommunikation mit dem Bewohner beschrieben. Hat er Einschränkungen (Hörgeräte, Brille, Wortfindungsstörungen, nur nonverbale Kommunikation möglich, Mimik, Gestik, etc.)? Wie zeigen sich diese? Spricht er gerne Dialekt (Plattdeutsch)? Äußert der Bewohner Wünsche und Bedürfnisse oder verschweigt er diese und zeigt dies nur durch sein Verhalten?
9.1.3 Modul: Mobilität
Mobilität hat viel mit Autonomie zu tun. Beschreiben Sie die aktuelle Mobilität des Bewohners. Achten Sie darauf, wann und wie sich der Bewohner fortbewegt und wie er gerne sitzt und liegt. Beschreiben Sie alle Einschränkungen der Mobilität und welche Hilfsmittel der Bewohner nutzt. Bei Fixierungen ist die Art, Dauer und der Grund zu notieren.
9.1.4 Modul: Pflegerische Versorgung / Selbstversorgung
Körperpflege
Auf der Grundlage Ihrer Beobachtungen und des Kontaktes mit dem Bewohner beschreiben Sie den Hilfebedarf im Rahmen der Körperpflege. Besonders zu beachten sind Intimitäten und andere Gewohnheiten. Hier ist es besonders wichtig, den individuellen Ablauf der pflegerischen Versorgung zu beschreiben. Ziel ist es, die persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten darzustellen. Wann steht der Bewohner auf? Wie kommt er in das Badezimmer? Welche Reihenfolge ist er bei der Körperpflege gewohnt? Bei Bewohnern, die ihre Vorlieben nicht mehr selbst äußern können, ist es wichtig, einen gleichbleibenden Ablauf für alle Mitarbeiter zu beschreiben. Welches Begrüßungsritual gibt es? Wie sind die pflegerischen Abläufe gestaltet? Bei Bewohner, die den Ablauf der pflegerischen Handlungen selber festlegen, ist dies deutlich darzustellen.
Essen / Trinken
Es werden individuelle Ess- und Trinkgewohnheiten beschrieben (Lieblingsspeisen, Abneigungen, Essenszeiten, Zwischenmahlzeiten, Hilfsmittel, etc.). Trägt der Bewohner eine PEG, so wird der Name der Nahrung, die Menge welche innerhalb von 24 Stunden vergeben wird, die Menge der Flüssigkeit innerhalb von 24 Stunden und die entsprechenden Durchflussgeschwindigkeiten in der Pflegekarte dokumentiert. Hier wird ebenfalls erfasst, ob einen Anregung der Geschmacksinne zu den gewöhnlichen Mahlzeiten durchgeführt werden muss. Wenn dies durchgeführt wird, muss in der Pflegekarte dokumentiert sein, wie diese Maßnahme erfolgt. Wenn bestimmte Kontrollen notwendig sind, verweisen Sie auf: Trinkprotokoll, Gewichtskontrolle, Blutzuckerkontrolle, BMI, etc.
Ausscheidungen / Toilettengang
Beschreiben Sie, wie sich der Bewohner bei Ausscheidungen verhält. Sie können auch einen möglich vorhanden Schamaspekt beschreiben. Zeigen Sie auf, welche Signale des Bewohners beobachtet werden müssen (z.B. wird unruhig, etc.). Notieren Sie die Häufigkeit der Unterstützung, ob ggf. Abführmittel verabreicht werden, oder jemand eine bestimmte Ernährung benötigt. Kommen Hilfsmittel zum Einsatz? Es wird dokumentiert, wann der Wechsel der Inkontinenzprodukte erfolgt (Uhrzeiten angeben). Welches Inkontinenzprodukt genutzt wird, ist dem Plan im Badezimmer des Bewohners zu entnehmen. Bei regelmäßig geführten Toilettengängen sind die Intervalle (Uhrzeiten) in der Pflegekarte zu notieren.
Ruhen / Schlafen
Beschreiben Sie die Schlafgewohnheiten des Bewohners. Hat er bestimmte Rituale? Leidet er an Schlaflosigkeit? Was hilft ihm, gut zu schlafen? Hält er Mittagsschlaf und wo?
9.2. Risikofaktoren / Pflegefachliche Einschätzung
Ergeben sich aus der Anamnese Risikofaktoren, so wird das erfasste Risiko unter "Verhalten / Erleben" beschrieben und notwendige Maßnahmen sind zu planen. Notwendige Ausschlüsse von Risiken werden, je nach Expertenstandard, ebenfalls dokumentiert. Die Planungen der Maßnahmen erfolgt auf Grundlage bestehender Expertenstandards und hauseigener Standards und Prophylaxen. Diese müssen individuell dem Risiko des Bewohners angepasst sein. Die Maßnahmen werden auf der Pflegekarte dokumentiert. Bei der Evaluation müssen die Maßnahmen auswertet werden. Hat die geplante Maßnahme das Risiko vermindert, oder gar aufgehoben? Liegt ein Assessmentinstrument vor, ist die Auswertung mit dem vorhandenen Instrument durchzuführen. In der Pflegeprozessplanung wird, die Evaluation dokumentiert und ggf. das erhobene Risiko angepasst. Ist ein Risiko nicht mehr vorhanden, wird dies leserlich gestrichen. Gibt es kein hinterlegtes Assessmentinstrument, so muss in der Pflegeprozessplanung eine Aussage im Zusammenhang mit der Evaluation getroffen werden. Im Bereich der Behandlungspflege kann auf bestehende Standards verwiesen werden, jedoch sind individuelle Gewohnheiten ebenfalls zu erfassen. Findet eine Beratung oder Aufklärung des Bewohners statt, wird dieses mit dem Ergebnis in der Pflegeprozessplanung unter "Betreuung / Pflege" festgehalten.
10. Pflegekarte
Auf der Pflegekarte wird handlungsleitend, vor allem unter Nutzung von Items (Symbole), die Art der Hilfestellung bei der pflegerischen Versorgung und Betreuung des Bewohners beschrieben. Erforderliche Prophylaxen, die sich aus der pflegefachlichen Einschätzung ergeben, werden handlungsleitend dokumentiert. Beispiel: Bei regelmäßigen Lagerungsintervallen wird die Uhrzeit und die Art der Lagerung angegeben (z.B. re - li 30 ° alle 2 Stunden, in der Nacht um 22.00 und 5.00 Uhr, Hilfsmittel: 4 – Kammer Kissen) alternativ wird auf den Bewegungsplan verwiesen.
11. Stammblatt (Vorgehensweise, keine Ausfüllhilfe)
Das Stammblatt ist Bestandteil der Informationssammlung. Vorliegende Informationen aus dem Anmeldformular und dem Erstgespräch zum Einzug mit der Leitung Sozialer Dienst oder Pflegedienstleitung werden durch die Verwaltung eingetragen. Im Aufnahmegespräch mit der Pflegefachkraft werden am Tag des Einzuges die Daten vervollständigt. Während des Aufenthaltes des Bewohners oder Gastes wird das Stammblatt durch die Beziehungspflegefachkraft aktuell gehalten.
12. Biografiebogen
Folgt.
13. Medikamentenblatt
Im Medikamentenblatt des Pflegedokumentationssystems sind alle Arzneimittel aufgeführt, die ein Bewohner durch das Pflegepersonal erhält.
Unverträglichkeit und Allergien auf Arzneimittel, sowie andere wichtige Besonderheiten (z.B. Medikation mit Marcumar) werden formlos im „Kopfteil“, links neben die Jahresangabe des Medikamentenblattes dokumentiert und farblich auffallend gekennzeichnet (z.B. durch Unterstreichung mit Rotstift). Dieser zusätzliche Vermerk im Medikamentenblatt sorgt dafür, dass diese Informationen bei der Verordnung neuer Medikamente Beachtung finden. Ebenfalls ist auf eventuelle Wechselwirkungen zu achten. Bei Verordnungen durch Fachärzte wird zusätzlich das Fachgebiet hinter dem Medikamentennamen aufgeführt
Jedes Arzneimittel, welches durch einen Arzt an- oder abgesetzt wird, muss mit Datum und Handzeichen kenntlich gemacht werden. Das Datum muss den Tag, den Monat und das Jahr ausweisen. Beim Absetzen eines Arzneimittels reicht die Angabe „bis Packungsende“ nicht aus. Ist der verordnende Arzt nicht anwesend, sollte die Verordnung schriftlich per Fax erfolgen. Im Medikamentenblatt erfolgt ein Vermerk „lt. Fax v. 07.04.04/Hdz.“und ein Hinweis, wo das Fax abgelegt ist. Das Handzeichen des Arztes wird beim nächsten Hausbesuch nachgeholt. Sollte auch dies nicht möglich sein, wird dem Arzt der entsprechende Eintrag in der Dokumentation am Telefon vorgelesen und durch den Arzt mündlich genehmigt. Dies wird mit dem Kürzel VuG (Vorgelesen und Genehmigt) durch die Pflegefachkraft bestätigt. Die Pflegefachkraft trägt im Bericht ein, dass sie mit dem Arzt telefonisch Rücksprache gehalten hat. Die Pflegefachkraft darf nur Arzneimittel vergeben, die eindeutig von einem Arzt verordnet worden sind. Ist ein Medikament abgesetzt worden, wird dieses leserlich durchgestrichen.
Bedarfsmedikamente werden nur unter streng definierten Voraussetzungen verabreicht. Außerdem ist zu beachten, dass sedierende Arzneimittel nur in begründeten Ausnahmefällen im Sinne einer Bedarfsmedikation verordnet werden sollten. Die Gesamtanzahl der verordneten Bedarfsmedikamente und damit die Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich der Vergabe von Arzneimitteln durch Pflegefachkräfte sollten begrenzt sein, da sonst die Verordnungskompetenz auf die Pflegefachkräfte verlagert wird. Die Bedarfmedikation muss für den Bewohner vorrätig sein. Sie muss eine Einzel- und Tageshöchstdosis definiert haben. Es muss eindeutig beschrieben sein, wann der Bedarf besteht. Allgemeine Symptomaussagen sind nicht ausreichend.
Bei einer Infusion ist die Einflussgeschwindigkeit in Milliliter pro Stunde (ml/h), Tropfen pro Minute (Trpf./min.) oder zumindest eine Angabe über die vorgesehene Dauer der Infusion zu notieren. Die vom Arzt einmal jährlich durchgeführte Grippeschutzimpfung wird ebenfalls dokumentiert.
Die Dosis des einzelnen Medikaments muss eindeutig sein und kann arzneimittelbedingt unterschiedlich sein. Zunächst sollten alle Medikamente mit Stückzahlen angegeben werden. Dazu sind entsprechende Spalten zu nutzen.
Alle Medikamente müssen mit dem vollständigen Namen aufgeführt werden. Dies beinhaltet die Wirkstoffstärke, Wirkstoffweise und die Darreichungsform. Alle Aufgeführten Arzneimittel müssen mit den vorgehaltenen Präparaten übereinstimmen. Mögliche Generika-Präparate müssen ausgewiesen sein. Weicht der Vergabezeitpunkt von den üblichen Zeiten ab (z.B. bei Antibiotika, BTM), muss die genaue Uhrzeit der Vergabe dokumentiert werden. Bei Medikamenten, die nicht jeden Tag verabreicht werden (z.B. Depot-Arzneimittel, Schmerzpflaster), werden die genauen Tage für die Vergabe angegeben (z.B. montags und donnerstags, an jedem geraden Tag).
Folgende Abkürzungen werden verwendet:
Tabletten: Tbl.
Kapseln: Kps.
Tropfen: Trpf.
Lösungen: Lsg.
Suppositorium: Supp.
Sublingual: s.l.
Subcutan: s.c.
Intramuscular: i.m.
14. Kontrollblatt
In die Kopfzeile eines jeden Blockes wird eingetragen, für welche Werte die Eintragungen erfolgen (z.B. RR, Puls, Temperatur, BZ, Gewicht). Bei der Eintragung eines Temperaturwertes muss zusätzlich die Meßmethode / der Ort der Messung vermerkt werden (axillar: ax. / rektal: rec.). Bei Ermittlung des Nüchtern-Blutzuckers wird zusätzlich zur Uhrzeit der Hinweis „nü“ dokumentiert.
15. Nachweise
Das exakte Führen der Nachweisblätter ist aus fachlicher und leistungs- / haftrechtlicher Sicht notwendig. Die Durchführung von Tätigkeiten, wie sie in der Pflegeprozessplanung beschrieben sind, wird mit dem Handzeichen bestätigt. Alle Nachweisdokumente müssen lückenlos geführt werden. Das Abzeichnen der durchzuführenden Maßnahmen erfolgt einmal pro Dienst durch die ausführende Pflegkraft oder durch die verantwortliche Pflegefachkraft im jeweiligen Dienst. Die Nachweise sind zeitnah zu erbringen, spätestens am Ende des jeweiligen Dienstes. Die Dokumentation erfolgt in der Regel im Bewohnerzimmer.
Grundpflege
Im Bereich "Ausscheidungen" wird in der Zeile „Stuhlgang“ der Stuhlgang mit einem senkrechten Strich erfasst. Durchfälle werden mit einem „D“ in der gleichen Zeile dokumentiert. Im Pflegebricht wird bei Durchfallerkrankungen der weitere Verlauf, die eingeleiteten Maßnahmen und das Befinden des Bewohners beschrieben.
Medizinische Pflege
Das Formular "Durchführungsnachweis medizinische Pflege" wird hinsichtlich der durchzuführenden Maßnahmen individuell angepasst. Nachzuweisen sind z.B. folgende Leistungen:
- Stellen der Medikamente im Wochendispenser
- Vergabe von oralen Medikamenten
- Verabreichung von subkutanen Injektionen / Infusionen
- Beaufsichtigung venöser Infusionen
- Vergabe von Augentropfen / -salben
- Verbandswechsel
- Anlegen von Kompressionsverbänden
- Blasenspülung
- Wechsel des Dauerkatheters
- Anus-praeter-Versorgung (Plattenwechsel)
- Tracheal-Kanülen-Versorgung
- Medizinische Einreibungen
- Sauerstoffgabe
Grundlage der Behandlungspflege ist die ärztliche oder pflegerische Anordnung, die auf dem Formular „Fragen an den Arzt / ärztlichen Anordnungen" oder dem Medikamentenblatt dokumentiert ist. Die durchzuführenden Maßnahmen werden benannt. Festgehalten werden Art der Maßnahme, ggf. Lokalisation und der geplante Zeitpunkt der Durchführung (Uhrzeit oder „morgens“, „abends“ etc.). Ausführende Mitarbeiter sind Pflegefachkräfte oder eingewiesen Mitarbeiter. Für die Vergabe von Bedarfsmedikamenten ist für jedes Medikament eine gesonderte Zeile zu nutzen. Im Pflegebericht wird zusätzlich der Medikamentenname, verabreichte Dosis, Angaben zum Grund der Vergabe und Wirkung des Bedarfsmedikaments dokumentiert. Hier muss ersichtlich werden, wie und in welcher Form die Vergabe gewirkt hat.
16. Pflegebericht
Im Pflegebericht sind aussagekräftige, verständliche, nachvollziehbare und präzise Aussagen zur aktuellen Situation des Bewohners zu dokumentieren. Der Sachverhalt soll ohne Wertung / Interpretation wiedergegeben werden. Festgehalten werden pflegerelevante Geschehnisse, bewohnerbezogene Fragen, als auch Anmerkungen für die Pflegekräfte der folgenden Schicht. Informationen zum Befinden und Wohlbefinden des Bewohners betreffen z.B.:
- Allgemeinzustand
- Mobilität
- Bewusstseinslage
- Orientierungsfähigkeit
- Grundstimmung
- Verhalten und Erleben
- „Hinlauftendenz“ von Bewohnern.
- Verhalten, welches den Bewohner selbst oder andere gefährdet
- Akute Verschlechterung des Gesundheitszustandes / Notfälle
- Ablehnung von Therapiemaßnahmen, z.B. Verweigerung der Medikamenteneinnahme (mit Begründung)
- Verlust von Gegenständen des Bewohners
- Besuche von Angehörigen bzw. anderen Personen und deren positive als auch negative Auswirkungen
- Positive Kontaktmomente
Die Eintragungen haben mindestens einmal täglich zu erfolgen. Bei Bewohnern mit gleichbleibender Versorgungsstruktur, Stimmung und Betreuung kann es ausreichend sein, einmal wöchentlich einen Pflegebericht zu schreiben. Dieser hat den Charakter einer wöchentlichen Zusammenfassung.
17. Signalleiste
Die Bedeutung der Farbreiter ist dem Deckblatt der Dokumentation zu entnehmen. Alle Farbreiter bleiben solange aktiv, bis die Inhalte des Pflegberichtes nicht mehr aktuell sind.
18. Fragen an den Arzt
Im Formular werden alle relevanten Angaben zu ärztlichen Verordnungen festgehalten, die nicht im Medikamentblatt erfasst werden. Dies betrifft die Verordnung von Sondenkost, besonderen Therapien wie Krankengymnastik, Logopädie und allen weiteren behandlungspflegerischen Maßnahmen, z.B. Nutzung von ATS / MTS, Blasenspülung, Sauerstoffgabe, Absaugen, Übernahme von Vitalwertkontrollen / diagnostischen Maßnahmen und das Führen einer Flüssigkeitsbilanzierung. Auf dem Formular können ebenfalls pflegerisch notwendige Anordnungen im Bereich von Behandlungspflegen durch eine Pflegefachkraft festgelegt werden (Vitalwertkontrollen, Flüssigkeitsbilanzierung, Einreibungen, etc.).
19. Pflegeverlegungsbericht
Der Pflegeverlegungsbericht dient der Informationsweiterleitung zwischen pflegerischen Einrichtungen. Ein Pflegeverlegungsbericht ist bei jedem Bewohner und Gast vorzuhalten. Der Pflegeverlegungsbericht ist mit allen Informationen vorausgefüllt, die erfasst werden können. Bei einer Einweisung in ein Krankenhaus oder Überleitung in eine pflegerische Einrichtung oder für den ambulanten Dienst, ist der Bericht kurz vorher mit alle Angaben zu vervollständigen.
Notfallsituationen
In lebensbedrohlichen Notfallsituationen ist es nicht immer möglich oder sinnvoll, den Pflegeverlegungsbericht dem Notarzt mitzugeben. Sobald das Krankenhaus bekannt ist, wird der persönliche Kontakt mit der Station gesucht und ggf. der Pflegeverlegungsbericht gefaxt.
20. Indikationsformulare
20.1. Wunddokumentation
Für jede Wundsituation wird ein eigenes Dokumentationsblatt verwenden. Die ärztlichen Verordnungen und alle Wundverläufe werden hier dokumentiert. Die Wunddokumentation wird ausschließlich von examinierten Pflegekräften geführt. Dieses Blatt wird nur für folgende Bewohner bzw. in folgenden Situationen eingesetzt:
- Bei bestehendem Dekubitus
- Bei generell schlecht heilenden Wunden
- Bei chronischen Wunden.
Alle weiteren Behandlungspflegen werden weiterhin nachvollziehbar auf dem ärztlichen Anordnungsblatt und dem "Durchführungsnachweis medizinische Pflege" notiert. Bei Beratungsbedarf kann jederzeit der zuständige Wundexperte innerhalb der Einrichtung hinzugezogen werden.
20.2. Bewegungsplan
Ein Bewegungsplan ist bei allen Bewohnern zu führen, die aufgrund einer Bewegungseinschränkung eine Gefährdung aufweisen, einen Dekubitus zu entwickeln, oder eine bereits bestehende Wunde haben. Im Bewegungsplan werden alle Bewegungen des Bewohners erfasst. Darunter fallen auch alle Mikrobewegungen und Transferleistungen.
Lagerungsintervalle, sowie zu berücksichtigende Mobilitätsressourcen sind der Pflegeprozessplanung unter "Modul: Mobilität" zu entnehmen. Der Bewegungs- und Lagerungsplan wird täglich lückenlos geführt. Die Lagerungsart wird mit den entsprechenden Kürzeln laut Legende eingetragen. Die Durchführung des Lagewechsels ist mit dem Handzeichen zu bestätigen. Der Fingerdrucktest ist neben dem Handzeichen zu vermerken. Ist dort kein Zeichnen, lag keine Rötung vor. Dies muss der Pflegeprozessplanung zu entnehmen sein.
20.3. Inkontinenzversorgung / Toilettentraining
Das Formular wird zur Planung einer Versorgungsstruktur bei Bewohnern mit einer Inkontinenzversorgung eingesetzt. Es dienst zur Überprüfung von individuellen Ausscheidungsgewohnheiten. Im Besonderen wird es zur Ermittlung und Planung eines erfolgreichen Toilettentrainings genutzt.
20.4. Schmerz
Bei allen Bewohnern mit chronischen Schmerzen und bei gehäuft auftretenden Schmerzäußerungen eines Bewohners wird durch die Pflegefachkraft in individuell festgelegten Zeiträumen eine systematische Scherzerfassung zur Beurteilung der Schmerzsituation durchgeführt. Je nach Kognition des Bewohners wird entweder die Schmerzerfassung anhand der nummerischen Rangskala (NRS) oder der Beurteilung des Schmerzes bei Demenz (BESD) durchgeführt.
Nach erfolgter Schmerzerfassung wird das Ergebnis durch die Pflegefachkraft ausgewertet und es werden weitere Maßnahmen geplant. Es erfolgt ein Eintrag in das Schmerzverzeichnis.
20.5. Einfuhrprotokoll
Das Einfuhrprotokoll wird bei Bewohnern geführt, die einen schlechten Ernährungszustand aufweisen oder wo es im Verlauf zu einer Veränderung des Ernährungszustandes kommt. Die Erfassung ist so lange durchzuführen, wie es entweder der Hausarzt anordnet, die Pflegefachkraft es fachlich als notwendig erachtet oder aber mindestens für 7 Tage. Die Erfassung wird täglich nach allen Mahlzeiten durch die durchführende Pflegekraft geführt. Im Spätdienst werden die täglichen Trinkmengen zusammengerechnet und das Ergebnis notiert. Die Auswertung des Protokolls erfolgt durch die Pflegefachkraft, die im Anschluss für die weitere Maßnahmenplanung verantwortlich ist.
21. Wichtige zu dokumentierende Informationen
Stammblatt
"Ärztlicher Aufnahme Status Diagnosen". Die Diagnosen sind durch den Hausarzt abzeichnen zu lassen. Falls im Laufe der Zeit Diagnosen hinzukommen, sind diese von der zuständigen Pflegefachkraft einzutragen. Bei einem vorliegenden Arztbrief / Krankenhausentlassungsbericht kann auf diesen Verwiesen werden, bis der Hausarzt sein Handzeichen nachgeholt hat. Aus dem Verweis muss hervorgehen, wo sich der Arztbrief befindet.
Pflegehilfsmittel
Es sind alle Pflegehilfsmittel zu dokumentieren. Alle Lieferscheine werden an die Pflegedienstleitung gegeben. Nach erfolgter Registrierung durch die Pflegedienstleitung, erhält die Etage den Lieferschein zur Abheftung in die Bewohnerarchivmappe zurück.